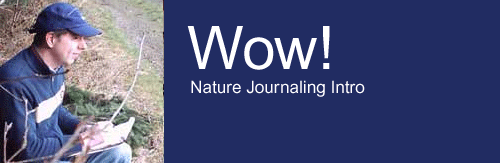Schreiben als Mittel zur Erkenntnisgewinnung und zur Reflexion
Beim schlichten Abschreiben von Texten können wir gleichzeitig über ganz andere Dinge nachdenken. Beim Formulieren von eigenen Texten ist dies nicht möglich, denn „eigenformuliertes Schreiben bedeutet Konzentration und ein Zu-sich-Kommen“ (Memminger 2007, S. 33). Durch Schreiben gelingt es dabei „bleibende Spuren – wenn nicht auf dem Papier, dann in uns selbst“ (Illich/Sanders 1988, S. 17) zu hinterlassen. Es kommt zu einem Erkenntnisgewinn.
Unterschieden werden kann zwischen Wissen wiedergebendem Schreiben und Wissen schaffendem Schreiben. Wenn wir Wissen wiedergebend schreiben, dann schreiben wir auf, was wir zuvor schon gewusst haben, das was wir erlebt oder gelernt haben, es handelt sich um „biographisches Wissen aus unserer Wirklichkeit, das wir abrufen und wiedergeben können“ (Brugger 2004, S. 57). Dieses Wissen können wir „ohne besondere Umstrukturierung und ohne weitere Bewertungsprobleme oder Umstrukturierungs-Notwendigkeiten“ (ebd.) aufschreiben, allerdings ohne neue Erkenntnisse hinzu zu gewinnen. Solches Niederschrieben kennt man aus der Schule, wo der Schüler auswendig gelerntes Wissen nahezu unverändert abspult. Während des Schreibens findet kein Lernprozess statt.
Folgt man Brugger, dann verzichten wir, wenn wir nur Wissen wiedergebend schreiben, auf die Möglichkeit, ein neues Verständnis von den an einer Angelegenheit beteiligten Zusammenhängen schreibend zu entwickeln, unsere Erfahrungen zu reflektieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Vermeiden bedeutet eine „Aussparung des bewussten Weiter-Denkens, der Reflexion, der Auseinandersetzungen mit den ‚Inhalten’ beim Schreiben“ (Brugger 2004, S. 61).
Wissen schaffendes Schreiben hingegen ist eine wirkungsvolle Form des „Weiterverarbeitens eigenen Wissens“ (Eigler 1990, S. 109), bei der der Schreiber während des Schreibprozesses zu einer „Neuorganisation des Wissens im Hinblick auf eine bestimmte Themenstellung, eine bestimmte Zwecksetzung und einen bestimmten Adressatenkreis“ (ebd.) gezwungen wird. Diese Arbeitsweise, die „unabhängig vom Wissensstand immer wieder dazu zwingt, sein Wissen einer Ordnung zu unterwerfen“ (Molitor-Lübbert 2003, S. 36) kann zur Gewinnung neuer Erkenntnisse führen, da man sein bisheriges Wissen besser durchschaut und „neue Beziehungen im eigenen Wissen aufleuchten, dabei auch Unklarheiten und Unstimmigkeiten im eigenen Wissen bewußt werden“ (Eigler 1990, S. 109). Molitor-Lübbert (2003, S. 35) bezeichnet das Schreiben als Materialisierung von Gedanken, diese Verbalisierungsprozesse umfassen mehr als nur das Aneinanderreihen von Wörtern, „sondern auch viele Schritte der Konkretisierung, die sich zum Teil abwechselnd auf der mentalen, averbalen Ebene und der verbalen schriftlichen Oberfläche abspielen, teilweise auch zwischen den beiden Ebenen auf dem Weg vom Gedanken zum Wort“. Der Wissen schaffende Schreiber überprüft und hinterfragt seine Erfahrungen und erarbeitet sich „im Sinne einer dialektischen Verschränkung von Aneignung und Vergegenständlichung eine neue Wirklichkeit, seine Wirklichkeit“ (Koch / Pielow 1984, S. 44). Dabei bildet das Schreiben Erfahrungen nicht nur „sichtbar oder vorstellbar ab, sondern, es treibt sie weiter, differenziert sie, weitet sie aus“ (ebd., S. 43). Das reflektierende Denken während des Schreibprozesses bewirkt eine intensive und kritische Auseinandersetzung mit dem Text, der Schreiber entdeckt die volle Tragweite seiner Gedanken, wenn nötig revidiert er diese und bleibt so in ständiger Auseinandersetzung mit dem Text und entwickelt sein eigenes Wissen weiter (vgl. Molitor-Lübbert 2003, S. 38).
Der „Zwang zur Reflexion“ (Memminger 2007, S. 33), der beim Schreiben von eigenen Texten notwendig ist, fällt allerdings manchen Menschen schwer und ist einer der Gründe, weshalb viele „Schwierigkeiten mit dem Formulieren haben“ (ebd.). Darüber hinaus ist nicht jeder Schreibende aus Mangel an Schreibkompetenz in der Lage sich mit seinem Text intensiv auseinander zusetzen. Damit trotzdem ein Reflexionsprozess angestoßen werden kann, kann es hilfreich sein, „wenn Personen einbezogen werden, die nicht zum Kreis der unmittelbar Beteiligten gehören“ (Bräuer 2003, S. 145). Bräuer meint, es sei „die fremde Stimme, die von den Schreibenden nach langer Arbeit an den eigenen Texten besonders intensiv wahrgenommen wird“ (ebd.). Dies können Personen aus der Arbeitsgruppe sein oder auch Freunde und Bekannte, die als Testleser ihre Meinung äußern sollen. Dieses Testlesen und die anschließend geäußerte Meinung, bedeuten nicht, „dass daraus auch immer Textveränderungen erwachsen“ (ebd.), doch durch die kritische Betrachtung von außen soll der Schreiber zum Nachdenken über seinen Text angeregt werden. So kann es sein, dass der Schreiber einige Passagen überarbeitet, andere Textstellen aber „verteidigt“ und unverändert lässt. Der Erwachsenenbildner soll hier aber nicht als Korrektor oder Lehrer auftreten, sondern mehr als Berater, der Problemlösungsstrategien und Methoden anbietet.