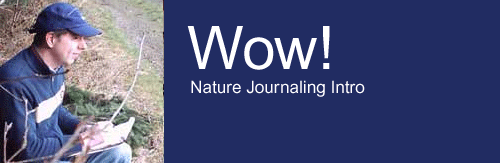Schreiben als Lern- und Denkmethode
In der einfachsten Form wird Schreiben zur „Verdauerung flüchtiger Gedanken“ (Molitor-Lübbert 2003, S. 33) genutzt. Durch das Mitschreiben der gesprochenen Sprache kann der Schreiber das was er hört in den dauerhaften Raum der Sprache absetzen, „allein durch diesen Akt kann Wissen, von Rede getrennt, geboren werden“ (Illich/Sanders 1988, S. 17). Durch die Notizen, die z.B. Teilnehmer in einem Seminar machen, indem sie Inhalte mitschreiben, schaffen sich die Teilnehmer einen „externen Speicher und entlasten damit das Gedächtnis“ (Molitor-Lübbert 2003, S. 33).
Im Alltag, beim schnellen Verfassen von Briefen oder E-Mails, dient Schreiben als Kommunikationsinstrument dem „Austausch von Informationen über Zeit und Raum hinweg“ (ebd.). Schreiben ist aber „viel mehr als nur Datenspeicher und Kommunikationsinstrument: Es ist zusätzlich noch Denkwerkzeug“ (Scheidt 2006, S. 15), denn „das Denken beeinflusst das Schreiben, und umgekehrt“ (Molitor-Lübbert 2003, S. 33). Weiterhin wurde festgestellt, dass „sich sowohl beim Lernen als auch beim Schreiben ähnliche Denkprozesse“ (Hofer 2006, S. 117) einstellen, so dass man allgemein sagen kann, dass „Schreiben Lernprozesse unterstützt und fördert“ (ebd.). Bei einer bewussten Anwendung des Schreibens als Denkmethode, kann das Schreiben dabei als „Verlangsamung des Bildungsprozesses“ (Behrens-Cobet/Reichling 1997, S. 39) betrachtet werden, bei dem es weniger um das Ergebnis des Schreibens (dem Text als Produkt) geht, „sondern um die Muße des Rückerinnerns, um Assoziationen, um einen in der Dynamik des Seminargeschehens so nicht praktikablen Denk-Prozeß, der stärker individuelle Verarbeitungsmuster zur Entfaltung bringt“ (ebd.). Statt der Beschleunigung der Wissensaneignung, die vielfach im Vordergrund steht, ist beim Schreiben als Denkmethode das reflexive Erinnern und Überdenken wichtig, welches als Verknüpfung von bereits bestehendem Wissen mit neuen Erkenntnissen angesehen werden kann.
Imdem dem Lerner mehr Zeit zum Denken gegeben wird und er sich in einem bestimmten Zeitraum nicht nur ein paar Notizen macht, die das Resultat seines Denkprozesses darstellen, sondern einen mehr oder weniger langen Text formuliert, der später nicht nur als Gedächtnisstütze dient, sondern auch bereits die Ausformulierung darstellt, wird der Teilnehmer „gezwungen“ bereits zu diesem Zeitpunkt seine Gedanken zu strukturieren. Dabei besteht die Möglichkeit, den Text nicht nur in einem Schwung zu schreiben, sondern der Text kann überdacht, korrigiert oder verbessert werden.
In Seminaren, bei denen in Gesprächen denken und sprechen nahezu gleichzeitig erfolgen, können die individuellen Unterschiede der einzelnen Teilnehmer nicht kompensiert werden. Hier ist der Schnelldenker und -sprecher in zweierlei Hinsicht im Vorteil: der Vortrag des Gedachten bleibt ohne Stockungen verständlich und die wesentlichen Gedankengänge werden direkt vorgetragen. Wohingegen die Personen, die mehr Zeit zum Nachdenken benötigen, spontan nur einen Teil ihrer Gedanken vortragen können. Durch Schreiben wird zwar der Seminarablauf verzögert, allerdings erhalten nun alle Teilnehmer genügend Zeit ihre Gedanken zu sortieren und zu formulieren.
Eine wesentliche Voraussetzung zum Verfassen von Texten ist die Schreibkompetenz, die bei Erwachsenen in sehr unterschiedlichem Maße vorhanden sein kann. Erfahrene Schreiber und Schreibnovizen werden nicht nur qualitativ unterschiedliche Texte produzieren, sondern sie werden Schreiben auch ganz unterschiedlich als Denkwerkzeug einsetzen können. Daher ist insbesondere für unerfahrene Schreiber eine „Herausarbeitung von Problemlösungsstrategien“ (Hofer 2006, S. 90) wichtig. Diese sollen zum bewussten Nachdenken über den Schreibprozess, über Ziele und Struktur der Texte, über die Wirkung beim Leser sowie zur Analyse und Bewertung von fremden und eigenen Textinhalten anregen. Der begleitende Erwachsenenbildner, mit dem Wissen über den Textproduktionsprozess und dessen Einflussfaktoren sowie gute Kenntnisse in seinem Fachgebiet, wird dazu die passenden Methoden vorstellen, die den Lernern als Problemlösungs-strategien und zur Entwicklung einer Schreibkompetenz dienen sollen.
Beim Schreiben sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die Einfluss auf den Text nehmen können. Hausdorf und Stoyan fassen diese Faktoren in einem Rahmenmodell des Textproduktionsprozesses (vgl. Hausdorf / Stoyan 2005, S. 115) zusammen. Sie unterscheiden drei Hauptkomponenten: Textproduzent, physische Umgebung und soziale Umgebung.
Der Textproduzent wird beeinflusst von seiner Motivation, seinem Interesse am Thema, seinem Gedächtnis und den kognitiven Prozessen. Kann der Lerner sein Thema selber wählen, dann kann von einer intrinsischen Motivation ausgegangen werden. Bei einem fremdgesteuerten Thema wird der Lerner eher extrinsisch motiviert sein. Nicht jeder Schreiber wird seine Schreibunlust bei einem ihn nicht interessierenden Thema durch Selbstmotivation überwinden können (vgl. Fix 2006, S. 28), sondern wird resignieren und abbrechen. Mit Teilnehmerorientierung wird versucht „durch das Aufspüren der Interessen intrinsische Motivation zu fördern“ (Wolf/Peuke 2003, S. 38).
Beim Schreiben spielen sowohl das Kurzzeitgedächtnis (aktuelle Eindrücke, gerade stattfindender Denkprozess), als auch das Langzeitgedächtnis (das gespeichertes Wissen, die autobiografische Erinnerung) eine Rolle.
Die kognitiven Prozesse beinhalten die Textinterpretation der Quelltexte, die Informationsaufnahme, die Reflexion der Informationen und die unmittelbare Textproduktion. Mit Metareflexion werden die eigenen kognitiven Prozesse des Schreibers, wie Gedanken, Meinungen und Einstellungen berücksichtigt. Beim Schreiben ist das metakognitive Wissen wichtig, wobei das „Nachdenken über das eigene Denken“ (Fix 2006, S. 21) gemeint ist, bei dem die „Vorgehensweise bei der Textproduktion“ (ebd., S. 22) reflektiert wird.
Zur physischen Umgebung können das Produktionsmedium (Computer, Stift und Papier), Aufzeichnungen und Fachtexte sowie der bisher produzierte Text gehören. Beim Produzieren des Textes findet eine “Rückkopplungsschleife zwischen Schreiben und Lesen“ statt, bei der „das Schreibprodukt vom Standpunkt des Schreibers inhaltlich und formal beurteilt wird“ (Molitor-Lübbert 2003, S. 38).
Bei der Sozialen Umgebung spielen Adressanten und die Koautoren eine Rolle. Die Leser sollen beim Formulieren berücksichtigt werden. Es soll auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden und in ihrer Sprache geschrieben werden. Fix spricht in diesem Zusammenhang von der „Fähigkeit der Leserantizipation“ (Fix 2006, S. 27), die der Schreiber sich aneignen soll. Bei der Zusammenarbeit mit weiteren Autoren kann der Grad der Zusammenarbeit sehr unterschiedlich sein und von der ausschließlichen Besprechung und Abgrenzung des Themas bis hin zum gemeinsamen Formulieren eines Textes reichen.