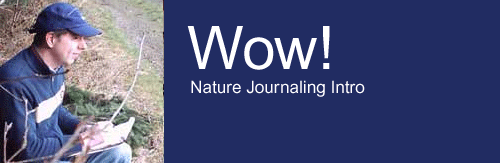Zusammenarbeit von stark und niedrig involvierten Bürgern
Im Internet besteht nicht nur die Möglichkeit Texte zu lesen, zu kommentieren und zu veröffentlichen, jeder kann auch Diskussionen initiieren. Das „demokratisch-interaktive Potential des Online-Diskurses“ (Diemand / Mangold / Weibel 2007, S. 13) kann vollends in einer „moderierten, deliberativen Eliten-Kommunikation“ (ebd.) ausgespielt werden, in der Zusammenarbeit aktiver „Bürgerinnen und Bürger, die in kleinen Akteursgruppen öffentliche Angelegenheiten besonders intensiv erörtern“ (ebd.). Diese Personen beteiligen sich aktiv im Sinne einer partizipatorischen Demokratie, in dem sie Social Software (dies sind Werkzeuge des Internet, wie Gästebücher, Weblogs, Foren, E-Mail oder Wikis, mit denen ein Online-Diskurs geführt werden kann) nicht nur schlicht zur Darstellung ihrer subjektiven Ansichten verwenden, sondern engagiert in einer Projektgruppe zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Bei einer herkömmlichen Projektgruppe, bei der sich die Projektmitglieder von Angesicht zu Angesicht treffen, kann Social Software die Zusammenarbeit zwischen den Treffen ergänzen und sogar verstärken.
Der Kern der Projektgruppe beschäftigt sich intensiv mit den Arbeitsaufgaben. Darüber hinaus gibt es Personen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht intensiv an dieser Arbeit beteiligen, aber gerne über den Projektstand informiert sein möchten, bei Teilfragen behilflich sind oder durch Kommentare der Kernprojektgruppe helfen möchten. Um dies zu ermöglichen, muss die Kernprojektgruppe bereit sein auch Zwischenergebnisse zu präsentieren und eine Kommentarmöglichkeit zu schaffen.
Mayfield (2006) hat die Zusammenarbeit von stark und niedrig involvierten Personen in einem „Power Law of Participation“-Modell dargestellt. Während die niedrig involvierten Personen Texte lesen und kommentieren, schreiben die stark involvierten Personen, moderieren, leiten das Projekt und übernehmen somit die Kernaufgaben. Dieses Modell zeigt, „wie Menschen mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten zum und unterschiedlichen Ansprüchen an das eigene Engagement individuelle Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden können“ (Maier 2007, S. 288).
Der Grad der Involviertheit hängt weniger von der zur Verfügung stehenden Zeit und den technischen Möglichkeiten ab, sondern vielmehr von der Motivation und der Selbstlernkompetenz des Projektmitglieds. Bei der Selbstlernkompetenz kann zwischen hoch- und wenig-selbstgesteuerten Personen unterschieden werden. Hoch-selbstgesteuerte Personen weisen „einen größeren Vollendungswunsch, höhere Anstrengung, mehr Aufmerksamkeit und eine größere intrinsische Motivation auf“ (Schüßler 2007, S.98), sind aber andererseits „weniger an der Zusammenarbeit mit anderen interessiert“ (ebd., S. 99). Die wenig-selbstgesteuerten Personen sind zwar stärker an einer Zusammenarbeit interessiert, bei ihnen ist aber das Konkurrenzdenken ausgeprägter und sie sehen den Lernprozess „weniger als eigenen Gestaltungsspielraum“ (ebd.). Mangelnde Selbstlernkompetenz kann demnach dazu führen, dass Personen ungewollt zu niedrig involvierten Projektmitgliedern werden, wodurch ihr Selbstwertgefühl gering bleibt und sie sich daher auch nicht trauen sich verstärkt an der Projektarbeit zu beteiligen. Sie verharren, bleiben Leser, geben Informationen oder Kommentare, während sich die lerngewohnten, hoch-selbstgesteuerten Projektmitglieder in die Moderator- oder Leiter-Position aufschwingen. Diese, sich im Gruppenprozess ergebene Rollenverteilung kann von allen Mitgliedern akzeptiert werden oder sogar erwünscht sein. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass die niedrig in-volvierten Personen ihrer Potentiale noch gar nicht entdeckt haben, daher sollte es die Aufgabe des Leitenden sein, diesen Personen bei der Entdeckung ihrer Potentiale zu helfen und den Erwerb von Selbstlernkompetenz zu ermöglichen.