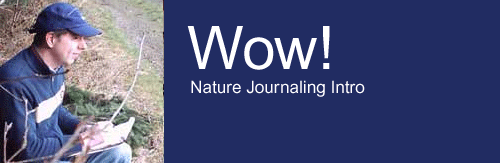Wie professionelle Schreiber die Bürger einbeziehen
Wirft man einen Blick in die Redaktionen der Massenmedien, dann lässt sich erkennen, dass dort die Autoren die Möglichkeiten haben, das Werkzeug Schreiben kreativ zur Erkenntnisgewinnung einzusetzen. Scheidt entdeckte in den Redaktionen „eine Atmosphäre von Gemeinsamkeit, die zumindest für den Typ des eher geselligen Schreibers wichtig ist“ (Scheidt 2006, S. 149), denn „die Arbeit in einem Team ist anregend, Kreativität in der Gruppe ist für viele Menschen eine ganz wesentliche Erfahrung“ (ebd.). Oft bleibt kooperative Teamarbeit allerdings „die absolute Ausnahme, obwohl sie eher zum Erfolg führt“ (Preger 2004, S. 8). Die Rechercheergebnisse werden zwar allen Redakteuren in einem Pool zur Verfügung gestellt, aber letztlich sitzt der Redakteur alleine „vor seinem Computer, vor seinem Blatt Papier, überlegt, formuliert, gestaltet. Genau genommen sitzt der Redakteur freilich nicht draußen, vor dem Schreibtisch und dem Papier – sondern drinnen in seinem Kopf. Denn dort spielen sich die Bewusstseinsvorgänge ab, dort arbeitet diese rätselhafte Maschinerie, die aus Beobachtungen oder Erinnerungen neue Gedanken und Bilder destilliert“ (Scheidt 2006, S. 150). Erst wenn der Schreibprozess beendet ist, kommunizieren die Redakteure über die Texte und üben konstruktive Kritik.
Bei der Kommunikation mit dem Leser kommt es aber zu einer technisch bedingten Kontaktunterbrechung (vgl. Luhmann 2004, S.11). Nach Luhmann kommt eine Kommunikation erst „zustande, wenn jemand sieht, hört, liest – und so weit versteht, dass eine weitere Kommunikation“ (Luhmann 2004, S. 14) sich anschließen könnte. Das Mitteilungshandeln alleine sei noch keine Kommunikation (vgl. ebd.). Vielmehr wird die Kommunikation zwischen Schreiber und Leser unterbrochen.
Bekommt der Bürger keine Einladung oder Ermunterung zur Mitarbeit an den Medien, bleibt auch das Engagement in diesem Bereich eine Ausnahme. Eine Kommunikation zwischen Medien und Bürger findet nur bedingt statt, sie wird durch „Zwischenschaltung von Technik“ (Luhmann 2004, S. 11) erschwert. Ausnahmen (z.B. Leserbriefe, Anrufe in den Sendeanstalten) sind möglich, wirken aber inszeniert und werden „in den Senderäumen auch so gehandhabt“ (ebd.). Leserbriefe an die Redaktionen werden von diesen geprüft und gekürzt.
Die Bürger in den Medien seien nicht Subjekte, bemängeln Medienkritiker, sondern „sie waren und sind immer Objekte: Es wird über sie geredet, es wird mit ihnen etwas gemacht [….] sie werden immer eingerahmt und kommentiert von professionellen Meinungsbildern“ (Wiengarn 2003, S. 8). So endet die Beteiligung des Bürgers oft bei Meinungsumfragen zu von Medienmachern ausgewählten Themen.
Die Möglichkeiten des Internet haben die Beteiligung der Bürger an den Medien deutlich gesteigert. Es entwickelte sich als Konkurrenz zu den bisherigen Medien ein Bürger- oder Mitmachjournalismus. Die professionellen Medienmacher erkannten, dass dem der „authentisch vom Leben erzählt, mit dem Charme der Unvollkommenheit und der Glaubwürdigkeit“ (Dresen 2006, S. 24), die jungen, modernen Mediennutzer den Vorrang geben, vor den „Privilegierten“ (Journalisten), die sich über die Mediennutzer erheben, indem sie „von der Höhe glanzvoller Blätter und ruhmreicher Sendeanstalten herab für sie auswählen und bewerten, was wichtig“ (ebd.) ist. Viele Zeitungen erkannten die Konkurrenz und nutzten die Chance, sie wollten nun nicht mehr nur für die Leser, sondern mit ihnen arbeiten. Nun ist es möglich über Rückkanäle im Internet die Artikel der Redakteure zu bewerten sowie zu kommentieren, und es gibt Bereiche, in denen Leser ihre eigenen Artikel veröffentlichen können.