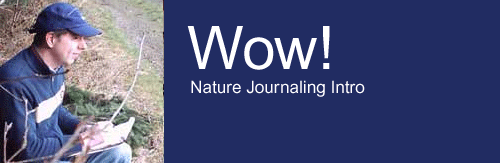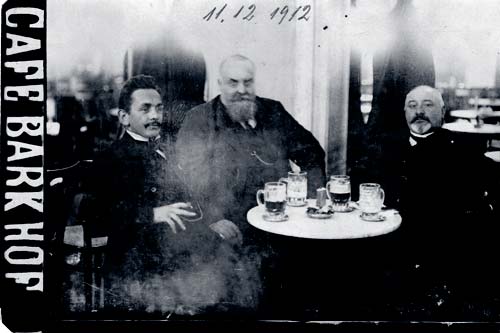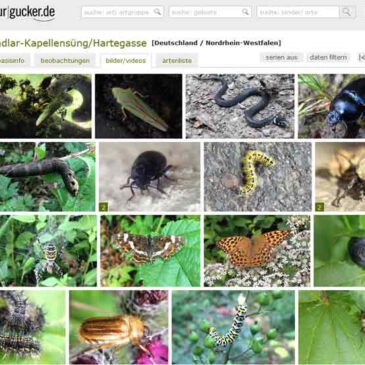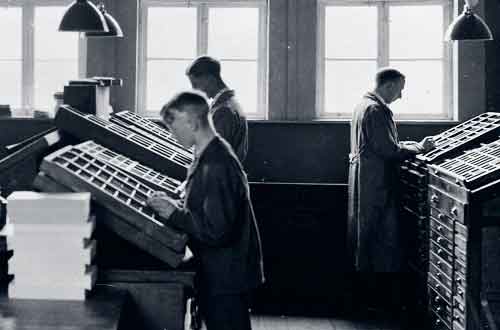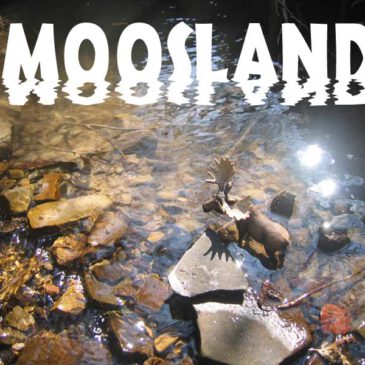Wow! Nature Journaling Education – Methodenbox
Zeichnen als Denkwerkzeug (Epistemisches Zeichnen, das wissens- oder erkenntnisgenerierende Zeichnen) Schreiben als Denkwerkzeug (Epistemisches Schreiben, das wissens- oder erkenntnisgenerierende Schreiben) (1) Der Erwachsene als Schreibnovize(2) Wie professionelle Schreiber die Bürger einbeziehen(3) Zusammenarbeit von stark und niedrig involvierten Bürgern(4) Schreiben als … Weiter